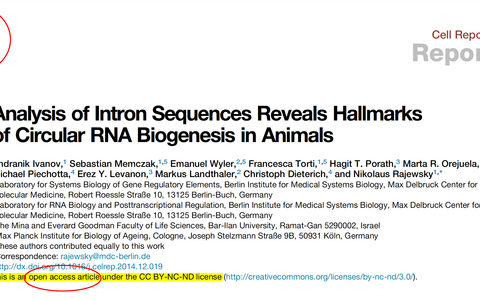„Open Access löst nicht all unsere Probleme“
Das MDC hat Prof. Ingo Morano gebeten, das Zentrum im Arbeitskreis Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft zu vertreten. Aus diesem Anlass haben wir Prof. Morano zum Thema Open Science und Open Access befragt.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Vertreter des MDC im Helmholtz-Arbeitskreis Open Science?
Ich vertrete darin einerseits die Haltung des MDC und die Interessen seiner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Andererseits transportiere ich die Informationen aus dem Arbeitskreis ins MDC, um auf diese Weise MDC und Helmholtz-Gemeinschaft in Open-Science-Angelegenheiten zu synchronisieren. Im Arbeitskreis beteilige ich mich an der Erstellung gemeinsamer Open-Science-Empfehlungen, im MDC stehe ich zusammen mit meinem Stellvertreter Wolf Schröder-Barkhausen aus der Bibliothek und der Leiterin der Bibliothek, Dr. Dorothea Busjahn, als Ansprechpartner in Open-Science-Fragen zur Verfügung.
Dabei geht es auch um Open Access. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Open Access wurde in der Budapester Erklärung von 2002 und in der Berliner Erklärung von 2003, die auch von der Helmholtz-Gemeinschaft unterzeichnet wurde, definiert. OA bedeutet, dass wissenschaftliche Literatur und Informationen unbeschränkt und kostenfrei weltweit der Öffentlichkeit elektronisch zugänglich sein sollten. OA hat sich seitdem in der wissenschaftlichen Gemeinschaft gut etabliert. Publizieren im Open-Access-Modus kann man sich in etwa so vorstellen: die Autorinnen oder Autoren reichen ihre – meist mit öffentlichen Mitteln finanzierten –Artikel als Manuskript ein und zahlen dann eine – üblicherweise wieder aus öffentlichen Mitteln finanzierte – „Author Processing Charge“, wenn die Manuskripte zur Veröffentlichung angenommen werden. In der Regel wird die akzeptierte Manuskriptversion des Artikels vom Verlag editiert und sofort als Originalversion im PDF-Format via Internet öffentlich und kostenlos zugänglich gemacht. Man bezeichnet das als „Open Access Gold“, oder spricht vom “Pay to Publish, Read for Free“-Modell.
Und das Geschäftsmodell der traditionellen Verlage verläuft umgekehrt.
Genau. Die Autorinnnen und Autoren stellen den Verlagen kostenlos – manchmal aber auch kostenpflichtig – ihr wissenschaftliches Manuskript zur Verfügung. Zudem treten die Autorinnen und Autoren ihre Rechte an ihren Publikationen an die Verlage ab, so dass eine Zweitverwertung nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Die Wissenschaftsinstitutionen müssen dann die Artikel entweder einzeln oder über Lizenzverträge und Subskriptionsgebühren zurückkaufen, ansonsten sind ihnen nur die kurzen Abstracts zugänglich bzw. der gesamte Zeitschriftentitel ist nicht verfügbar. Das Geschäftsmodell der traditionellen Verlage ist also vereinfacht ein „Publish for Free, Pay to Read“, häufig trifft man aber bereits auf „Pay to Publish, Pay to Read“, oder gar auf „Pay twice to Read“, wenn der traditionelle Verlag die Publikationen zusätzlich im Internet der Öffentlichkeit kostenpflichtig verfügbar macht. Da spricht man dann auch vom Hybrid-Modell oder von „Double Dipping“.
Gerade die Preispolitik der Verlage wird in der Wissenschaft oft heftig kritisiert.
Das stimmt. Die traditionellen Verlage haben sich ihre Leistungen in der Vergangenheit durch nicht nachvollziehbare Preissteigerungen vergüten lassen. Das hält immer noch an. Die dadurch hervorgerufene Bibliothekskrise ist bereits in die Annalen der Bibliothekswissenschaften eingegangen. Wissenschaftliche Artikel werden den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von den Bibliotheken heutzutage überwiegend in elektronischer Form zugänglich gemacht, die Printversionen sind abbestellt und spielen im Bereich STM - „Science, Technology and Medicine“ - kaum noch eine Rolle, viele Zeitschriften sind nicht mehr zugänglich, weil ihre Lizenzgebühren nicht mehr finanziert werden können. Das sind kaum zu vertretende Verhältnisse, nach wie vor aber Usus und durch die Abhängigkeit unseres Wissenschaftssystems vom Verlagssystem erklärbar. Das ist nicht nur ökonomisch paradox, sondern widerspricht der legitimen Forderung von Wissenschaft und Öffentlichkeit nach uneingeschränktem Zugang zu Daten und Informationen, deren Erzeugung von der öffentlichen Hand finanziert wurde.
Und Open Access schafft da Abhilfe?
Das Modell, so, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, löst einige, aber nicht alle der angesprochenen Probleme, die das „Publish for Free, Pay to Read“ Modell der traditionellen Verlage aufwirft. So sind die von OA-Verlagen veröffentlichten Artikel tatsächlich kostenlos elektronisch zugänglich, eine Weiterverwertung ist unter Beachtung der jeweils geltenden Lizenz ohne weiteres möglich. Was den ersten Teil des OA-Geschäftsmodells betrifft, also „Pay to Publish“, mussten wir in den vergangen Jahren aber ganz analog zu den traditionellen Verlagsmodellen eine Kostenexplosion registrieren, die völlig inakzeptabel ist. Sie belastet nicht nur die Etats der Bibliotheken, sondern gefährdet die gesamte Open-Access-Bewegung und wirkt sich auch global aus.
Was meinen Sie mit global?
Schon heute stellen die hohen „Article Processing Charges“ der OA-Verlage für unsere Kolleginnen und Kollegen aus Schwellenländern eine finanzielle Hürde dar und erschweren deren Zugang zum Wissenschaftssystem zusätzlich. Eine weitere beunruhigende Entwicklung ist die sprunghafte Zunahme unseriöser Verlage, die kaum oder gar keine Qualitätskontrolle der eingereichten Manuskripte durch Peer Review mehr vornehmen, sondern sich nur noch an den Article Processing Charges bereichern. Ich möchte da nur kurz auf Jeffrey Beall verweisen, der eine Liste solcher Predatory Publisher führt. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt.
Sehen Sie eine Alternative zum bisherigen Verlagswesen, das mit seinen Journalen ja eine Qualitätskontrolle und „Torwächter“-Funktion für sich beansprucht?
Das bisherige Verlagswesen, sei es der traditionelle oder Open Access Verlag, hat ohne Zweifel mit seiner Kompetenz und Erfahrung als Gatekeeper und seinen Leistungen, was Qualitätskontrolle durch Peer-Review, Archivierung und Bibliometrie betrifft, an der Entwicklung der Wissenschaften und der Verbreitung von Information einen ganz großen Anteil. Damit sind wir meiner Erfahrung nach sehr gut bedient.
Sehen Sie eine andere Möglichkeit, die Gatekeeper-Funktion auszufüllen als durch die bisherigen Journale (zum Beispiel durch Open Peer Review)?
Im bislang angewandten Peer Review Prozess sind die Autorinnen und Autoren eines eingereichten Manuskriptes den Gutachtern bekannt, die Gutachter dagegen bleiben anonym. Dieses etablierte Modell wird schon so lange hinterfragt wie es existiert.
Was halten Sie konkret von Open Peer Review?
Nature hat in 2006 einen „Trial for Open Peer Review“ gestartet, mit einem enttäuschenden Interesse der Leserschaft für Open Peer Review. Man sollte auch erwähnen, dass Ansätze für Open Peer Review schon praktiziert werden. So erlauben viele wissenschaftliche Journale Kommentare der Leserschaft zu veröffentlichten Artikel, die ihrerseits auch publiziert werden können, wenn sie konstruktiv sind. Ich persönlich halte das etablierte Peer Review Modell mit Open Peer Review Ansätzen als nach wie vor ausreichend. Was mir viel mehr Sorgen bereitet ist die stete Abnahme der Qualität der Gutachten beim Peer Review, die von mir selbst aber auch von Kolleginnen und Kollegen beobachtet wird. Da besteht aus meiner Sicht Handlungsbedarf.
Nochmals zur Preispolitik der Verlage. Denken Sie, dass hier eingegriffen werden soll? Und falls ja, durch wen?
Der Markt im STM-Bereich wird von den „Big Four“ dominiert, deren Marktposition durch die diesjährige Fusion von Macmillan, dem Nature-Verlag, mit Springer weiter ausgebaut wurde. Inwiefern marktregulierende Behörden direkt in die Preispolitik der Verlage eingreifen können, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber man kann auch die Randbedingungen regulieren und versuchen, den Wettbewerb im STM-Verlagswesen zu entzerren. Beispielsweise könnte eine Aufwertung des „Grünen Weges“ der Open Access Bewegung, d.h. die Veröffentlichung einer Zweitversion eines Artikels in Repositorien wissenschaftlicher Institutionen, durch eine mutigere Novellierung des Copyrights durchaus hilfreich sein. Bisher erlaubt unser Urheberrecht den Autorinnen und Autoren eine Zweitveröffentlichung der Artikel erst ein Jahr nach Erstveröffentlichung, und dann auch nur als Manuskriptversion. Die editierte Originalversion des Artikels bleibt den traditionellen Verlagen vorbehalten. Ich fürchte, daran wird sich auch nach einer Novellierung des Urgeberrechts wenig ändern. Die Zweitveröffentlichung in Manuskriptform bringt einige Nachteile für die Leserschaft mit sich, insbesondere, wenn die Manuskriptversion nicht genau mit der Originalversion übereinstimmt. Oftmals gibt es keine zuverlässige letzte Manuskriptversion, da Endkorrekturen der Manuskripte direkt online in die Verlagssoftware geschrieben werden. Da wäre es hilfreich gewesen, wenn die Zweitveröffentlichung der Originalversion erlaubt wäre. Ich empfinde auch die genannte Einjahresfrist angesichts der rasanten Entwicklungen der modernen Wissenschaft als viel zu lang. Eine Vierteljahresfrist wäre da realistischer. Dadurch könnten sich, nach Ablauf einer wissenschaftlich vertretbaren Frist, endlich die Originalversionen als Zweitveröffentlichung auf den Grünen Weg in die Repositorien machen und die Manuskriptversionen ersetzen. Ein so aufgewerteter Grüner Weg würde nicht nur wirksam die Open Access Bewegung stärken, sondern auch die Preispolitik der traditionellen Verlage erträglicher machen und wäre für die Open Access Verlage ein deutliches Signal, über ihre Author Processing Charges gründlich nachzudenken.
Was kann die Wissenschaft selbst tun?
Wir als Kunden der Verlage könnten etwas bewegen, z.B. indem wir angemessene Obergrenzen für Author Processing Charges von Open Access Verlagen einführen. Solche Obergrenzen werden bereits von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen definiert, sind aber meiner Meinung nach regelmäßig viel zu hoch angesetzt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanzierte beispielsweise eine Author Processing Charge bis zu 2000 Euro pro Open Access Gold Artikel, was angesichts der tatsächlichen Verlagskosten von noch nicht einmal 300 Euro pro Artikel geradezu eine Steilvorlage für die Verlage darstellt, dann auch entsprechend hohe Gebühren einzufordern. Eine Obergrenze von, sagen wir, 500 Euro pro Open Access Gold Artikel, wäre da ein deutliches Signal von uns Kunden an die Verlage und würde die Wettbewerbsintensität zwischen den Verlagen steigern.
Das MDC hat ein eigenes Repositorium für die Publikationen unserer Arbeitsgruppen. Denken Sie, dass es genügend bekannt ist innerhalb des Hauses?
Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass unser Repositorium nur wenig bekannt ist und Manuskripte aus dem „Grünen Weg“ von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nur selten genutzt werden. Das hat sicherlich viele Gründe. Zum einen sind wir mit dem üblichen System der Literaturrecherche über PubMed in jeder Hinsicht immer noch ausgesprochen gut bedient und man benötigt nur in Ausnahmefällen zusätzliche Hilfe. Zum anderen werfen Zweitveröffentlichungen in Manuskriptform, die in den Repositorien abgelegt sind, wie schon erwähnt, praktische und wissenschaftliche Probleme auf.
Sollten die großen Forschungsförderorganisationen Ihrer Ansicht nach auf Open Access bestehen und zusätzlich Mittel dafür bereitstellen?
Aus der Open Access Community hört man schon häufig den Ruf danach, die Autorinnen und Autoren zu verpflichten, Open Access Gold zu publizieren. Ganz davon abgesehen, dass mich solche Rufe persönlich eher abschrecken, finde ich sie rechtlich problematisch. Sie greifen in die grundgesetzlich festgelegte Freiheit von Forschung und Lehre ein, und dazu gehört auch die Freiheit zu veröffentlichen. Dieser weise Paragraph unseres Grundgesetzes begleitet die Wissenschaften nun schon seit vielen Jahrzehnten und stand ihrer rasanten Entwicklung keinesfalls im Wege. Da würde ich nicht dran rütteln wollen. Einen selbstbestimmten Mix aus traditionellen und Open Access Veröffentlichungen ziehe ich vor. In dieser Hinsicht besteht am MDC Einigkeit, oder, um es mit den Worten der Leiterin unserer Bibliohek, Frau Dr. Busjahn, zu sagen: „Wir möchten gern von dieser Schwarz/Weiß-Darstellung weg und halten für die nächste Zeit ein Nebeneinander für sinnvoller“.
Was die Finanzmittel für Publikationen betrifft, gibt es zur Zeit allerdings ein Ungleichgewicht zu Gunsten der traditionellen Verlage: Lizenzen werden von den Institutionen voll finanziert, während die Article Processing Charges der Open Access Gold Verlage nur sehr begrenzt und nur von einigen wissenschaftlichen Institutionen getragen werden und daher noch meist aus den Budgets oder eingeworbenen Drittmitteln der Autorinnen und Autoren stammen. Ich trete dafür ein, dass wissenschaftliche Institutionen für OA-Gold-Publikationen im Sinne eines Open Access-Fonds zusätzliche Mittel bereitstellen. Das wäre auch im Sinne des Arbeitskreises Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft.
Was würden Sie von einem gemeinsamen Berliner Repositorium für Artikel (und gegebenenfalls Daten) halten?
Es ist selbstverständlich begrüßenswert, dass das Land Berlin in 2014 beschlossen hat, eine Open-Access-Strategie für sich zu entwickeln. In der Beschlussempfehlung zum Antrag der Piratenfraktion wird die Vernetzung der Berliner Repositorien ausdrücklich empfohlen. Dass die Einrichtung eines gemeinsamen Berliner Repositoriums, beispielsweise wie das der Helmholtz-Gemeinschaft, über die bereits bestehenden hinaus einen Mehrwert bringt, glaube ich nicht. Ziel kann es doch nur sein, Repositorien international zu vernetzen und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so leicht zugänglich zu machen, wie das beispielsweise bereits mit PubMedCentral der Fall ist, und wozu es bereits Initiativen gibt. Das würde Open Access wirklich unterstützten und die Position der wissenschaftlichen Institutionen gegenüber den Verlagen stärken.
Gerade in der biomedizinischen Forschung werden immer mehr Daten generiert, die den Rahmen herkömmlicher Journal-Artikel sprengen (bei uns zum Beispiel MRT-Daten, die Daten aus omics-Technologien). Wie kann eine digitale Infrastruktur geschaffen werden, die solchen datenintensiven Veröffentlichungen Rechnung trägt?"
Der offene Zugang zu Forschungsdaten, Open Data, ist neben dem offenen Zugang zu Publikationen, Open Access, eine zentrale Forderung von Open Science. Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten wurden schon in 2010 von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen formuliert und von der Helmholtz-Gemeinschaft mit unterzeichnet. Open Data ist eine riesige Herausforderung, weil eine intelligente Nachnutzung von Forschungsdaten hochkomplexe Voraussetzungen erfüllen muss. Sie müssen standardisiert und mit ausreichenden Metadaten versehen sein, technische und organisatorische Infrastruktur muss neu geschaffen werden, Informatiker, Forscher und Bibliothekare müssen zusammenwirken. Und das dann auch noch fachspezifisch und unter Wahrung der wissenschaftlichen und rechtlichen Interessen der Forscherinnen und Forscher sowie dem Schutz persönlicher Daten, um nur einige der Herausforderungen zu nennen. Um dies zu unterstützen, wurde 2014 der Arbeitskreis Open Science der Helmholtz-Gemeinschaft gegründet. In Ansätzen wird Open Data bereits praktiziert, z.B. in „Supplements“, die in immer größerem Umfang den Artikeln angehängt und gleich mit veröffentlicht werden. Es gibt öffentlich zugängliche Datenbanken, etwa die des National Centers for Biotechnology Information und Journals, die sich auf die Veröffentlichung von großen Primärdatenmengen spezialisiert haben. Am MDC haben wir uns angesichts der Herausforderungen von Open Science auf eine Strategie der kleinen Schritte verständigt. Wir wollen zunächst ein Daten-Repositorium für MDC-Veröffentlichungen einrichten. Das erlaubt nicht nur eine verbesserte Qualitätskontrolle der Publikationen, sondern stellt auch einen Kristallisationskeim für die Einrichtung und Vorhaltung viel größerer Forschungsdatenmengen aus dem MDC dar.
Sehen Sie akuten Handlungsbedarf für das MDC?
Da würde ich gerne drei Dinge anschieben: Einrichtung eines Open Access Publikationsfonds, eine offensivere Werbung für Open Access Gold Veröffentlichungen bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und die zügigere Etablierung des Daten-Repositoriums.