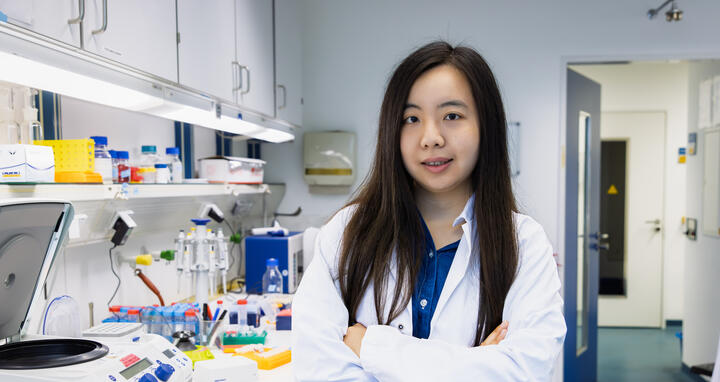Karriereschub durch wissenschaftlichen Austausch
Das Austauschprogramm für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center (MDC Exchange Program in Medical Systems Biology, früher MDC-NYU Exchange Program) wurde 2009 ins Leben gerufen, um die nächste Generation von Systembiolog*innen auszubilden. Zehn Promovierende können bis zu zwei Jahre am Center for Genomics and Systems Biology der New York University (NYU) oder an der MRC Human Genetics Unit der University of Edinburgh, einer neueren Partnerinstitution des Austauschprogramms, forschen und studieren.
Im Interview berichtet Yun-Hsuan Huang, Doktorandin im vierten Jahr in der Arbeitsgruppe „Allosteric Proteomics“ von Dr. Ilaria Piazza, über ihre Erfahrungen im Labor von Professor Nick Gilbert, dem Leiter der Arbeitsgruppe „Chromatin Structure and Genome Integrity Research“ an der University of Edinburgh.
Der Austausch hat mir eine ganz neue Sicht- und Denkweise eröffnet.
Wie hast du zum ersten Mal von dem Austauschprogramm erfahren?
Yun-Hsuan Huang: Ich bin darauf gestoßen, als ich mich für das PhD-Programm des Max Delbrück Center beworben habe. Es wurde in den Unterlagen erwähnt und es gab eine eigene Website, die erklärte, was das Programm bietet und wie es funktioniert.
War das ein Faktor bei der Entscheidung für das Max Delbrück Center?
Ja, durchaus, auch wenn persönliche Gründe ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Nach meinem Masterstudium in Dresden wollte ich weiterhin in der Nähe bleiben. Besonders gereizt hat mich allerdings der starke Fokus auf Strukturbiologie am Max Delbrück Center. Hier gibt es ein beeindruckendes Spektrum an Arbeitsgruppen, die zu Proteinstrukturen und -funktionen forschen – einschließlich meiner jetzigen Gruppe, die einen ausgezeichneten Ruf genießt.
Wie kam der Kontakt zum Gastlabor in Edinburgh zustande?
Die University of Edinburgh ist eine neuere Partnerinstitution in dem Programm. Zum ersten Mal habe ich von meinem Gastlabor auf einem Symposium gehört, bei dem mehrere Gruppenleiter*innen Vorträge hielten. Dort bin ich auf die Arbeitsgruppe von Nick Gilbert und seine Forschung aufmerksam geworden. Ihr Schwerpunkt liegt zwar eher auf Proteinbiochemie, aber mir schien das eine gute Gelegenheit zur Zusammenarbeit zu sein.
Woran hast du während des Austauschs gearbeitet?
Ich habe untersucht, wie krebsrelevante Stoffwechselstörungen die DNA-Topologie und die 3D-Chromatinarchitektur beeinflussen. Mein Heimatlabor in Berlin konzentriert sich auf die vielfältigen Rollen von Metaboliten im menschlichen Körper – insbesondere darauf, wie sie Proteinstrukturen und -funktionen beeinflussen, wofür wir proteomische Ansätze nutzen. Im Gilbert-Labor habe ich biochemische Assays eingesetzt, um eine aus meinen Proteomikdaten abgeleitete Hypothese zu überprüfen. Dabei habe ich einen speziellen Chromatin-Assay erlernt und angewandt, den diese Arbeitsgruppe entwickelt hat.
Was waren die Herausforderungen?
Die größte Herausforderung war der Zeitdruck. Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, daher mussten wir eine klar umrissene, realistische Frage formulieren und einen fokussierten Plan erstellen. Wir hatten mehrere Besprechungen mit Nick Gilbert, um unsere Ziele abzugleichen und sicherzustellen, dass die Assays aussagekräftige Ergebnisse liefern würden. Das erforderte schnelles Denken und rasche Anpassungen, wenn etwas nicht funktionierte.
Inwiefern beeinflusst der Austausch deine Arbeit hier?
Ich habe sowohl technisches Know-how als auch eine neue Perspektive mitgebracht. Wir planen, das gleiche Assay-System in unserem Labor einzurichten, und dank meiner Zeit in Edinburgh weiß ich nun, wie man das Protein unter bestimmten Bedingungen handhabt und typische Fallstricke vermeidet. Das ist eine direkte Weiterführung dessen, was ich in meinem Gastlabor gelernt habe.
Was hast du über die Experimente hinaus aus der Zusammenarbeit mitgenommen?
Unsere Arbeitsgruppe konzentriert sich stärker auf die Struktur des Proteoms, während sich Nick Gilberts Gruppe auf die Biochemie fokussiert. Das hat mir eine ganz neue Sicht- und Denkweise eröffnet. Außerdem bot mir der Austausch die Möglichkeit, im direkten Eins-zu-eins-Kontakt mit Menschen zu arbeiten – was auf Konferenzen nicht möglich ist. Man erfährt, wie andere Forschende vorgehen, welche Routinen sie haben und wie sie Probleme angehen.
Wird sich der Austausch langfristig auf deine Karriere auswirken?
Unbedingt. Die Menschen, die man kennenlernt, die Fähigkeiten, die man erwirbt, und selbst der Einblick in unterschiedliche Arbeitsstile – all das trägt zur Entwicklung als Wissenschaftler*in bei. Außerdem entstehen wertvolle Kontakte, die zu künftigen Kooperationen führen können.
Wie hast du die kulturelle Seite Schottlands erlebt?
Es war wunderbar! Edinburgh hat eine dynamische, künstlerische Atmosphäre mit vielen kostenlosen Museen und Galerien. Ich habe die Altstadt erkundet, Ausstellungen besucht und sogar einen stadtweiten Wissenschaftstag für Kinder in einem Museum miterlebt. Auch die Menschen waren unglaublich freundlich und zuvorkommend – ein Paar half mir sogar, die Straße zu überqueren, als die Ampel einmal ausgefallen war.
Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest?
Ich finde, Programme wie dieses verdienen mehr Beachtung. Sie bieten eine hervorragende Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, Wissen auszutauschen und wissenschaftliche Gemeinschaften miteinander zu verbinden. Ich hoffe, dass sich künftig noch mehr Doktorand*innen bewerben und davon profitieren werden.
Interview: Gunjan Sinha
Weiterführende Informationen
- MDC Exchange Program in Medical Systems Biology
- Interview mit Philipp Roth, PhD-Austausch an der NYU
- Nick Gilbert Research Group